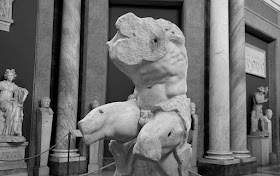|
| Claude Monet: Saint-Germain-l‘Auxerrois (1867); Berlin, Alte Nationalgalerie (für die Großansicht einfach anklicken) |
Claude Monet (1840–1926), der heute bekannteste und wohl auch beliebteste der französischen Impressionisten, hat nicht nur zahllose Ölbilder von Gärten, Blumenwiesen, Parklandschaften, Flussufern und Meeresküsten gemalt, sondern auch rund zwei Dutzend Ansichten von Paris. Die ersten entstanden im Frühsommer 1867, im Jahr der zweiten großen Pariser Weltausstellung. Eine dieser frühen Ansichten der Pariser Innenstadt möchte ich hier vorstellen – sie zeigt von einem erhöhten Standpunkt den Blick auf die spätgotische Kirche Saint-Germain-l’Auxerrois. Monet hatte hierfür seine Staffelei auf den Louvre-Kolonnaden aufgestellt, also auf der Ostseite des damaligen Herrschersitzes Napoleons III., wofür ihm eine Sondergenehmigung erteilt wurde.
 |
| Saint-Germain-l‘Auxerrois heute ... |
Monet hat die Dachkonstruktion der Kirche genau beobachtet, ebenso die Fensterrosette auf der giebelgekrönten Westseite, die beiden Treppentürme, die Strebepfeiler und Fialen. Vom linken Bildrand abgeschnitten, für den Betrachter also nicht sichtbar, sind der unmittelbar anschließende, 1860 eingeweihte neugotische Turm und die ebenfalls neu errichtete Mairie des ersten Arrondissements, die die Fassade des Gotteshauses imitiert. Am rechten Bildrand ist eines jener großen Wohnhäuser abgebildet, die auch die neuen breiten Pariser Boulevards bis heute säumen. Möglicherweise hat der Künstler für seine Komposition auf eine fotografische Vorlage zurückgegriffen: Eine etwa zur gleichen Zeit entstandene Aufnahme, die neben der Kirche auch das neugotische Rathaus zeigt, stimmt nahezu mit dem Blickwinkel von Monets Gemälde überein. Daran ist nichts Ehrenrühriges, denn Monet wollte ja gerade diejenigen Effekte abbilden, die eine Schwarzweiß-Fotografie unmöglich erfassen konnte: die Farben von Himmel, Zinkdächern, Steinen, Straßenpflaster und Laubwerk, das facettenreiche Wechselspiel von weißem Licht und blauen Schatten „sowie die atmosphärische Umhüllung der Motive“ (Shackelford 2021, S. 53).
 |
| ... und auf einer Fotografie aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts |
 |
| Claude Monet: Quai du Louvre (1867); Den Haag, Gemeentemuseum |
 |
| Claude Monet: Le Jardin de l‘Infante (1867); Oberlin/Ohio, Allen Memorial Art Museum |
 |
| Edouard Manet: Musik im Tuileriengarten (1862); London, National Gallery (für die Großansicht einfach anklicken) |
Inspiration fürs seine Darstellungen könnte Monet durch seinen Malerkollegen Edouard Manet (1832–1883) gewonnen haben, z. B. aus dessen Bild Musik im Tuileriengarten (1862), das 1867 auf einer Einzelausstellung während der Pariser Weltausstellung zu sehen war. 1869 sandte Monet seine drei Paris-Ansichten zum jährlichen „Salon“ – sie wurden abgewiesen, woraufhin der Maler sie im Schaufenster eines Farbenhändlers in der Rue Lafayette der Öffentlichkeit präsentierte.
 |
| Claude Monet: Boulevard des Capucines (1873); Moskau, Puschkin-Museum |
Erst 1873 schuf Monet erneut zwei größere Pariser Ansichten – nun aber im deutlich impressionistischen Malduktus. Monet richtete sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des berühmten Fotografen Nadar (1820–1910) ein: Von 1860 bis 1872 befand sich dessen Atelier in den beiden obersten Geschossen eines Hauses am Boulevard des Capucines, einer kurz zuvor unter Baron Haussmann modernisierten Prachtstraße. Nachdem er dort ausgezogen war, vermietete Nadar die Räume an andere Nutzer. Das untere der beiden Stockwerke lag etwa so hoch wie die Kolonnaden, in denen Monet im Louvre gearbeitet hatte; in Nadars ehemaligem Atelier stellte der Maler seine Staffelei in der oberen Etage auf und hielt zwei Ansichten mit Blick nach Norden und Osten in Richtung der Place de l’Opera fest. Ebenso wie 1867 verwendete Monet zwei exakt gleich große Leinwände – ein Querformat, das heute im Moskauer Puschkin-Museum hängt, sowie ein Hochformat, das sich in Kansas City befindet.
 |
| Claude Monet: Boulevard des Capucines (1873); Kansas City, Nelson-Atkins-Museum |
In diesen eng verwandten Gemälden nahm Monet nicht die Weite des Himmels in den Blick, sondern die Häuserzeile auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Auf dem Querformat sind die Häuser in gelb schimmerndes Licht getaucht, während der Vordergrund im Schatten liegt; auf dem Hochformat ist das Licht hingegen gedämpft, sodass fast nirgends Schatten zu sehen sind und die Formen der Gebäude, Fuhrwerke und Passanten zu erkennen sind. Ebenso wie in Monets Gemälden von 1867 stimmen die Umrisse der Gebäude überein. Der Stil des Künstlers hatte sich seither allerdings so stark verändert, dass solche Einzelheiten auf der Bildfläche buchstäblich verschwimmen.
Literaturhinweise
Schuster, Klaus-Peter u.a. (Hrsg.): Manet bis van Gogh. Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne. Prestel-Verlag, München/New York 1996, S. 90-92;
Shackelford, George T.M.: Maler des modernen Lebens. Monets Stadtansichten In: Angelica Daneo u.a. (Hrsg.), Monet. Orte. Prestel Verlag, München 2021, S. 50-59;
Weiß, Susanne: Claude Monet. Ein distanzierter Blick auf Stadt und Land. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1997, S. 31-46.